Oleg Hollmann
Am Anfang steht, wie so oft, eine traditionsreiche Dichotomie. Die Frage, wie etwas erdacht werden kann, das grundsätzlich nicht existiert, lässt sich aus zwei Richtungen angehen, die isoliert jedoch selten zu einer befriedigenden Antwort führen. Dem ersten Ansatz zufolge ist es die Idee, die ihrer Realisation als einer durch Technologie ermöglichten Epiphanie harrt. Demgegenüber akzentuiert der zweite die lenkende Affordanz der zur Verfügung stehenden Werkzeuge. Häufiger muss man wohl oder übel den beiden mäandernden, sich teilenden und wiedervereinigenden Denkströmen folgen, um schließlich zum Verständnis für die Entstehung von genuinen Neuerungen zu gelangen.
Im Falle der elektroakustischen Musik, insbesondere in ihrer an Konzepten, Manifesten und Erklärungen reichen Frühzeit zwischen 1950 und 1960, lassen sich beide Richtungen verfolgen und diskutieren. „Technische Möglichkeiten trugen Charakteristika in die Musik hinein, die nicht musiktheoretisch vorgedacht oder geplant waren, es nicht einmal sein konnten.“ (Ungeheuer/Decroupet 1996, S. 142) – zu diesem Schluss kommen Elena Ungeheuer und Pascal Decroupet nach eingehender Betrachtung der zunehmenden Automation innerhalb der Kompositionsarbeit in den frühen Studios der Tonband-Ära. Doch bereits im Vorfeld der tatsächlichen Umsetzung klanglicher Entdeckungen war der Wunsch der Akteure elektroakustischer Musik nach künstlerischer Erneuerung und Distanz zum gewohnten Konzertbetrieb ein Paradigma der Arbeit im Tonstudio. Mit der Annahme, eine Traditionslinie aus dem Inneren der Musikgeschichte sei demnach ausgeschlossen, müssen bei der Suche nach Ursprüngen elektroakustischer Komposition deshalb musikfremde Bereiche miteinbezogen werden. Überraschenderweise bietet die Biologie hier Raum für eine Spurensuche nach Konzeptionen, die dem Klang aus Lautsprechern vorangingen. Beginnend bei den sich um die Mitte des 20. Jahrhunderts in statu nascendi befindlichen Studios in u. a. Köln, Paris, Mailand und bis hinein in die Gegenwart soll die Verquickung elektroakustischer Musik mit Denkfiguren und Erkenntnissen aus Biowissenschaften anhand einiger prägnanter Beispiele skizziert werden.
Ziel dieses Umrisses ist die anschließende Gegenüberstellung der Marksteine elektrifizierter Tonkunst mit einer von Hans-Jörg Rheinberger beschriebenen Klassifikation der Experimentieranordnungen. Unter Zuhilfenahme der von Rheinberger erörterten „epistemischen Dinge“ – Präparat, Modell, Simulation – soll damit der traditionsreiche Rückgriff der Musik auf die der Biologie entlehnten Denkfiguren durch Akzentuierung der jeweiligen Eigenschaften an Struktur und Tiefenschärfe gewinnen.
Lebendige Technik
In der spezifischen technologischen und kulturellen Situation der späten 1940er und der 1950er Jahre erweist sich die Idee eines ‚organischen‘ Aufbaus von Kompositionen als potentes Vehikel für die Entwicklung elektroakustischer Musik. Karlheinz Stockhausen kam durch den Einfluss des vielseitigen deutschen Forschers Werner Meyer-Eppler in Kontakt mit der jungen Wissenschaft Kybernetik und gewann daraus Inspiration für seine Kompositionskonzeptionen der 1950er und 1960er Jahre (vgl. Hopp 1998, S. 13-15). Die ‚Gründungsschrift‘ dieser aus der Informationstheorie hervorgegangenen Disziplin (Ebd.) ist die im Jahr 1948 erschienene Publikation Cybernetics or control and communication in the animal and the machine des Mathematikers Norbert Wiener. Hier zeigt sich bereits im Titel die der Kybernetik immanente Konvergenz der biologischen wie technischen Prozesse. Auf der anderen Seite des Atlantiks baute zeitgleich Louis Barron zu Eigenschwingungen fähige – gleichsam lebendige –, Röhrenschaltkreise, die ebenso auf den Ideen Wieners aufbauten und sich somit an Vorgängen in Nervenzellen ein Vorbild nahmen (Taylor o.D.). Das nichtreproduzierbare Verhalten der Schaltkreise wurde auf Magnettonband aufgezeichnet und brachte eine Vielfalt so unvorhersehbarer wie dynamischer Klänge hervor. Dem Ehepaar Bebe und Louis Barron gelang schließlich mit dem höchst originären Soundtrack zum Film Forbidden Planet (1956) ein Markstein der elektroakustischen Musik und zugleich der Filmmusik. Norbert Wieners Arbeit, die in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg die Wissenschaft der Kybernetik begründete, legt den Schwerpunkt auf die Untersuchung von Signalrückkopplungen, und zwar sowohl in chemischen und kognitiven Prozessen innerhalb von Lebewesen als auch in der an Reife und Wirkkraft gewinnenden Informationsübertragung in (Kriegs-)Maschinen. Die Zusammenführung von biologischen Prozessen und Technologie auf den Begriff der Information erfuhr 1959 durch den österreichischen Meeresbiologen Wolfgang Wieser eine weitere Ausarbeitung. Dessen Publikation Organismen, Strukturen, Maschinen baute auf Wieners Schrift auf und wurde nachweislich von Stockhausen rezipiert (Hopp 1998, S. 15).
Ein Beispiel für die künstlerische Wirksamkeit der Biologie im musikalischen Bereich stellt Henri Pousseurs Werk Scambi (1957) dar. Den dazugehörigen Arbeitsbericht publizierte der zum Kern der Schule rund um das Studio des Nordwestdeutschen Rundfunks (NWDR) in Köln gehörende Komponist in den von Hermann Scherchen herausgegeben Gravesaner Blättern (Pousseur 1959). Bei seinen Überlegungen stütze sich Pousseur auf den Artikel „Biology of art: initial formulation and primary orientation“ von Wladimir Weidlé. Darin postulierte der im Pariser Exil lebende Kunstwissenschaftler russischer Herkunft eine „biologieorientierte Theorie der Kunst“ (Weidlé 1957, S. 14, Übersetzung d. Autors, im Orig. “a biologically oriented theory of art”). Die Menschheit nutze und erweitere demnach die Natur nicht ausschließlich mittels eigenständiger technischer Erfindungen. Die Eigenschaften des Lebendigen bleiben laut Weidlé in den Produkten der menschlichen Vorstellungskraft erhalten. Die so entstehende Kunst sei damit eine „neue Natur“ (Weidlé 1957, S. 15, Übersetzung d. Autors, im Orig. “a new nature”), die jedoch dezidiert auf gleichen Prinzipien basiere und den gleichen Gesetzmäßigkeiten folge. Davon ausgehend wollte Pousseur in seinem Arbeitsbericht zur Realisierung von Scambi seine Manipulationen des Tonbands als ein organisches Verfahren verstanden wissen. Die wichtigsten Werkzeuge bei der Arbeit im Mailänder Studio stellten für den Komponisten neben Tonbandabspiel- und Aufzeichnungsgeräten ein Hallraum, ein Rauschgenerator (d. h. ein Zufallsgenerator der Frequenzen) sowie ein „Amplitudenselektor“ (ein Vorläufer von Gate-Prozessoren) dar. Die Kombination der beiden letztgenannten Geräte erlaubte Pousseur das Herausarbeiten von zufälligen und somit asymmetrischen Pegelspitzen – eine musikalische Schicht, die er eben durch diese Charakteristika als „[…] mit einem – wohl noch elementaren, aber umso unbestreitbaren – Leben beladen […]“ ansah (Pousseur 1959, S. 39). Mit dem Hinzufügen von Hall, insbesondere bei mehrfacher Ausspielung durch den Echoraum u. a. in umgekehrter Abspielrichtung, gelang es Pousseur, von der ersten, aus asymmetrischen Impulsen bestehenden Idee eine kontinuierliche Klangfläche herzuleiten. Die einzelnen Signale fungieren für Pousseur dabei als Keime einer Transformation zwischen Zeitlichkeit (Impulse) und Raum (quasi-stabile Klangreflektionen). Die so manifestierte Beziehung zwischen den beiden Dimensionen sowie zwischen den auf Band fixierten Klangschichten wurde ebenfalls als „organisch“, verwandtschaftlich eingestuft.
Diese künstlerische Übertragung biologischer Merkmale auf Techniknutzung im Tonstudio stiftet hier exemplarisch den für die elektroakustische Musik Kölner Prägung („Elektronische Musik“) charakteristischen Zusammenhang zwischen Mikro- und Makroebene der Komposition, von Klang und Form (vgl. Ungeheuer 2002, S. 24), auch wenn Pousseurs Denken mit Scambi sich zweifellos von der seriellen Strenge hin zu einer Konzeption löste, die auch Intuition, Offenheit und Spontaneität im Umgang mit Studiotechnik mit einbezog. Doch welche Beziehung besteht hier zwischen biologie-basiertem Konzept und musikalischer Umsetzung genau? Ist es die einer Analogie, einer rein sprachlichen Metapher (vgl. dazu Weidlé 1957, S. 2) oder gar eine bloße Assoziation? Zeichnet die Biologie für ein klingendes „Modell[]“ (Stockhausens Bezeichnung der frühesten ‚elektronischen‘ Werke, siehe Stockhausen 1955, S. 57) verantwortlich? Oder entstand in der Verbindung zwischen den der Biologie entstammenden Erkenntnissen und den hörbar gemachten Oszillatoren, Rauschgeneratoren, Tonbandgeräten eine gänzlich neuartige Techniknutzung, die wiederum die nachfolgende künstlerische wie wissenschaftliche Entwicklung in bestimmte Bahnen zu lenken vermochte?
Typologie des (musikalischen) Experimentes
Diese Fragen anzugehen, ist das Ziel des vorliegenden Textes. Dafür unternehme ich im Folgenden den Versuch, eine Systematik zu entwickeln, die das Beziehungsgeflecht ‚Biologie-Tontechnik‘ zumindest grob zu ordnen in der Lage wäre. Dazu soll an dieser Stelle der Faszination für künstlerisch-wissenschaftliche Grenzgänge nachgegeben werden und das Problem von der anderen, nämlich wissenschaftstheoretischen Seite dieses Spektrums betrachtet.
In seinem Artikel „Über den Eigensinn epistemischer Dinge“ benennt und erörtert der Wissenschaftshistoriker Hans-Jörg Rheinberger drei Entitäten, die im Verlauf eines Forschungsprozesses als „Platzhalter des jeweilig noch nicht Gewussten“ fungieren: Präparat, Modell sowie Simulation. Untermauert werden die Ausführungen mit Beispielen aus der Wissenschaftsgeschichte der Biologie. Die drei genannten „epistemischen Dinge“ unterscheiden sich nicht nur qualitativ, sondern ergeben in ihrer fortschreitenden Entwicklung einen Vektor, der zugleich den im 20. Jh. sich vollziehenden Wechsel von analoger zu digitaler Informationsübertragung anzeigt. Die drei „epistemischen Dinge“ lassen sich nach Rheinberger wie folgt erläutern:
Präparat: Bei gleicher Materialität wie das eigentliche Untersuchungsobjekt, verweist das Präparat als dessen „‚Reindarstellung‘“ zunächst indexikalisch vor allem auf sich selbst. Dennoch werden bestimmte Eigenschaften und/oder Prozesse in der geschlossenen Umgebung bspw. einer Petrischale isoliert, zur besseren Sichtbarkeit verstärkt und variierend wiederholt. Daraus entsteht eine iterative Eigendynamik der Forschung.
Modell: Konstitutiv für ein Modell ist ein Medienwechsel. In einem anderen Medium/Material werden bestimmte Eigenschaften des Untersuchungsgegenstandes herausgestellt, während andere zwangsläufig vernachlässigt werden. Werden chemische Prozesse auf der molekularen Ebene als mechanischer Aufbau ‚zum Anfassen‘ gezeigt – bspw. bei einer plastischen Moleküldarstellung –, erreicht die Differenz zwischen dem Darzustellendem und dessen Repräsentanten einen so hohen Grad, dass es sich von einem „metaphorischen Charakter“ des Modells sprechen lässt. Das Modell repräsentiert stets einen Teilaspekt des Modulierten. Diese Auswahl, und somit Bedeutungsverengung, ist ein intentionaler Akt, weshalb ein Modell untrennbar von seiner Funktion ist. Neue Daten werden – bei ständiger gegenseitiger Anpassung und Annäherung – aus der Oszillation zwischen Modell und Gegenstand gewonnen.
Simulation: Obwohl eng verwandt mit Modellen, erzeugt eine Simulation virtuelle Daten, die nicht mehr an natürliche Spuren des Untersuchungsgegenstandes gekoppelt sind und somit eine „eigene[] Wirklichkeit“ generieren. Die Unterscheidung zwischen Untersuchungsobjekt und Experimentieranordnung verliert an Bedeutung, die funktionale Repräsentation wird aufgehoben, das Reale wird zum Hyperrealen. Rheinberger bezieht sich hier ausdrücklich auf Jean Baudrillard (Rheinberger 2015, S. 162).
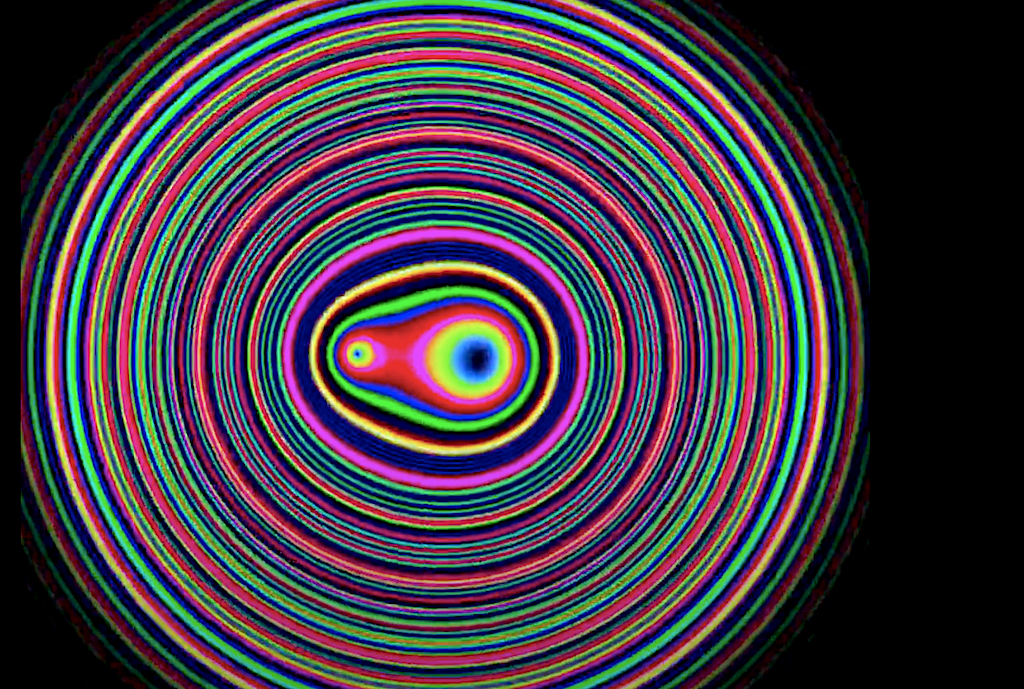
Der Entstehungsprozess von Scambi ließe sich in kühner Anwendung von Rheinbergers Typologie auf die Geschichte der elektroakustischen Musik der Kategorie Präparat zuordnen. Wenn Henri Pousseur unter Orientierung an ausgewählten Eigenschaften von Organismen Klänge extrahiert und in der ‚Petrischale Tonband‘ mittels Manipulationen deren verschiedene Ausprägungen ‚erforscht‘, folgt er zweifellos einer iterativen Entwicklung im Spannungsfeld technischer Klangerzeugung und -transformation. Trotz der Erörterung an einem historischen Beispiel bleibt die musikalische (oder nach Rolf Großmann „phonographische“) Arbeit an ‚Klang-Präparaten‘ keinesfalls der Frühzeit elektroakustischer Musik vorbehalten. In sich hinreichend geschlossene ‚Petrischalen‘ medialer wie ästhetischer Ausprägung zur Züchtung von ‚Soundkulturen‘ sind auch in der Gegewart häufig anzutreffen.
Die künstlerische Gegenüberstellung von tatsächlichen biologischen Systemen (oder präziser derer „Spuren“ nach Rheinberger) und Studiotechnik war laut Stefan Drees bereits in den 1960er und 1970er Jahren eine häufig anzutreffende Erscheinung (Drees 2017). Alvin Luciers Rückgriff auf Gehirnwellen in einem seiner bekanntesten Werke Music for Solo Performer (1965) lässt sich im Übrigen ebenfalls auf Norbert Wieners Vorarbeiten zurückführen. Die Spuren der Körperlichkeit (hier die Alpha-Wellen des Gehirns) werden durch analoge Tontechnik einem Medienwechsel ins Akustische unterzogen und als Schallwellen erfahrbar. In einem durch Rückkopplungen gekennzeichneten Prozess manifestiert sich die Schleife zwischen Performer*in und Technologie zu einem Kunstwerk. Diese Vorgehensweise – von Drees als Konzept unter dem Begriff „mixed media“ zusammengefasst – kann somit in der aufgeworfenen Systematik dem Modell zugeordnet werden. Trotz vielfältiger ästhetischer Tendenzen ist für die Arbeiten dieser Kategorie ein dynamisch-rekursives Wechselspiel der beiden kombinierten Ebenen – ‚natürliche‘ Signale und Technologie – charakteristisch. Die Inkommensurabilität der beiden Pole wird weitgehend ausgeblendet. Die analoge, metaphorische Verbindung dazwischen ist der eigentliche künstlerische Kern.
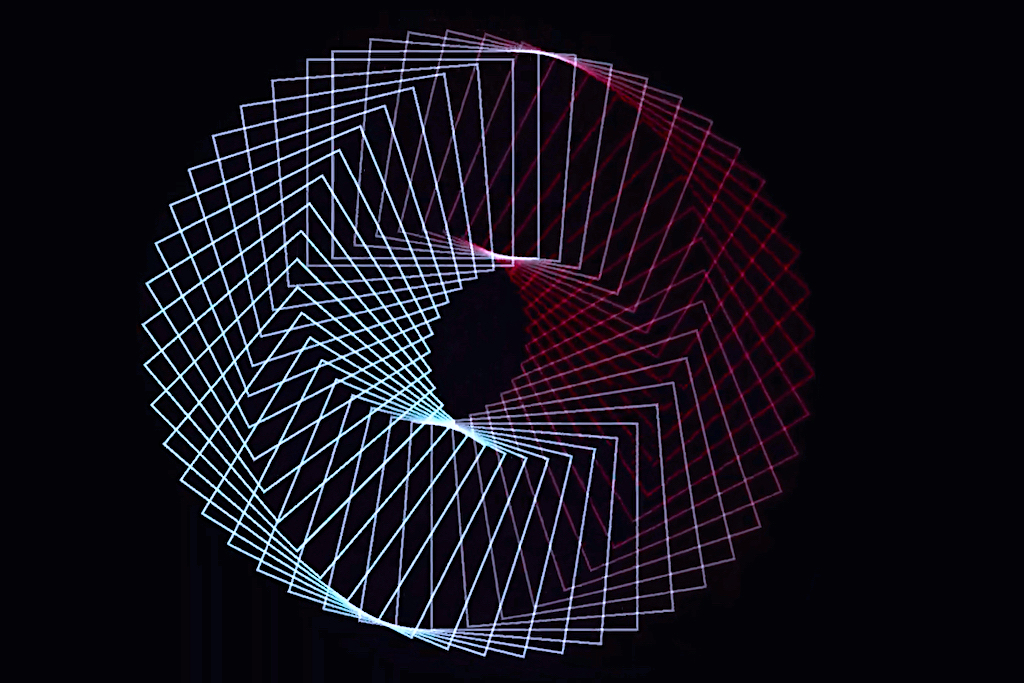
Der Vektor der Digitalisierung
Mit dem allgegenwärtigen Wechsel hin zu digitaler Technologie ging die ‚Vorbildfunktion’ der Biowissenschaften keinesfalls verloren. Ein eindrückliches Beispiel für den aktuellen Stand der technischen Entwicklung ist das multimediale Virtual-Reality-Projekt Mind The Brain!, das im Juni 2021 seine Premiere erlebte. Es wurde von Kathrin Brunner und Oliver Czeslik ins Leben gerufen und erfuhr Unterstützung seitens des Forschungszentrums Jülich (Human Brain Project) und der Bauhaus Universität Weimar. Regie führte Fred Kelemen, für die akustische Komponente im Spannungsfeld zwischen Komposition und Sound Design zeichnet der Berliner Komponist Nirto Karsten Fischer verantwortlich. Ausgangspunkt des Projektes ist der Wunsch, sich der „normativen Strukturen der Narration“ (Case Study im Rahmen des DOK.fest München; Übersetzung d. Autors) zu entledigen und den Teilnehmer*innen stattdessen eine Verbindung zu eigenen kognitiven Prozessen zu ermöglichen. Mittels eines Brain-Computer-Interfaces, dass die Gehirnaktivität abliest und interpretiert, soll der Mensch in eine wechselseitige Beziehung mit dem dadurch erfahrbaren inneren ‚Raum‘ der neuronalen Aktivität gebracht werden. Die künstlerische Umsetzung soll dafür sorgen, dass dies auf eine „poetische“ (Ebd.), intuitive Weise passiert: Die Bilder reagieren auf die Gehirnströme und bringen somit psychologische Zustände hervor, die wiederum für die Dynamik der „Experience“ (so die Eigenbezeichnung der Kunstform) entscheidend sind.
Die skizzierten Ideen bestimmen auch die Umsetzung der Klangspur des komplexen Werkes. Die an Elementen reichhaltige, auratische Klangarchitektur kristallisiert sich beim näheren Zuhören als eine Überlagerung mehrerer nicht synchronisierter Prozesse heraus. Als Vorbild dient dabei die Funktionsweise des menschlichen Gehirns selbst. Das ‚polyphone‘ Geflecht entfaltet sich dementsprechend während der VR-Experience mit einer Logik der Unabgeschlossenheit. Durch den offenen, prozesshaften Charakter der mit der visuellen Ebene verzahnten Komposition soll die Implizierung einer präexistenten Struktur vermieden werden. Dagegen ist die Förderung einer dem Inneren entspringenden, bewusst aktiven, kognitiven Tätigkeit der Teilnehmer erklärtes Ziel des Komponisten (dies wurde in einem persönlichen Gespräch zwischen N. K. Fischer und mir deutlich). Realisiert im skalierbaren 3D-Multichannel-Format „Ambisonics“, lässt ein umfangreiches Vokabular synthetischer und re-synthetisierter Klänge mittels stetiger Transformationen eine dynamische, mehrschichtige Klangwelt entstehen. Diese orientiert sich demnach an kognitiven Prozessen und vermag diese zugleich zu stimulieren. Im Spannungsfeld von Kunst und Naturwissenschaft lässt sich Mind The Brain! somit als eine fruchtbare Simulation (nach Rheinberger) verstehen, die tatsächliche Spuren der Gehirnaktivität zunächst in metaphorischer Form erfahrbar macht. Darüber hinaus verfolgt die Arbeit mit dem Vorstoß in für menschliche Sinnesorgane unerreichbare Bereiche das Ziel, originäre Erfahrungen und Stimuli zu kreieren. Die volle Wirkkraft der Kategorie Simulation wird im damit verbundenen politischen Impuls der künstlerischen Technikanwendung deutlich: Die VR-Erfahrung soll den Fokus der Teilnehmer*innen auf die Formbarkeit komplexer Systeme lenken. Diese Sicht- und Hörbarmachung einer sich in der Verschränkung zwischen Technologie und VR-Benutzer*innen öffnenden Gestaltungsfreiheit hat zum Ziel, ein Bewusstsein für Handlungsspielräume in Strukturen außerhalb des künstlerischen ‚Raums‘ der virtuellen Realität zu schaffen.

Vor dem Hintergrund der weltweiten COVID-19-Pandemie taucht im kultur- und kunstwissenschaftlichen Diskurs die Gegenüberstellung zwischen der Beschaffenheit und Wirkungsweise von Viren auf der einen sowie der Digitalisierung als gesellschaftstransformierendem Prozess auf der anderen Seite vermehrt auf. Obwohl aufgrund fehlenden Stoffwechsels per definitionem keine Lebewesen, sind Viren Untersuchungsgegenstand der Mikrobiologie. Mit Hilfe globaler Menschenströme der Netzwerkgesellschaft erfuhr der nahezu körperlose virale Code des Corona-Virus im Jahr 2020 in kürzester Zeit eine enorme Ausbreitung; die Menschheit selbst fungierte dabei als Datenleitung und Katalysator. Jenseits der strukturellen Vergleiche ist jedoch vor allem die Erkenntnis von Bedeutung, dass die viralen und digitalen Informationsübertragungen eine Neukalibrierung unseres Selbstverständnisses wie unserer sozialer Ordnung notwendig machen: „Die Vorstellung des Menschen als Akteur vor einer mehr oder weniger konstanten Naturkulisse weicht dynamischen Prozessen, in denen sich menschliches Handeln, technologische Operationen und natürliche Prozesse ineinander und miteinander verwoben entfalten” (Scherer 2020, o. S.; vgl. auch Burckhardt 2021, S. 38-39 u. S. 135). Es bleibt abzuwarten, inwiefern diese Deutung der Ereignisse Eingang in Kompositionsästhetik und Kompositionstechnik finden wird. Auch die Aufführungspraktiken könnten infolge der Pandemie von gänzlich neuen Koordinaten bestimmt werden. Demnach scheinen die Ausarbeitung und kritische Reflexion des Amalgams einer ‚digital-viralen‘ Logik der folgerichtige nächste Schritt für die an Gegenwartsproblemen interessierten Klangforscher*innen zu sein. In umgekehrter Richtung – aus der Naturwissenschaften kommend – sind bereits einige Beispiele für ‚Sonification‘ (vgl. Buehler 2020) zu finden.
Das Spannungsfeld zwischen Biowissenschaften und elektroakustischer Musik wird – so konnte gezeigt werden – durch ebenso nach Innovationen durstende wie traditionsreiche epistemische Anordnungen geprägt. Zweifellos wird der Dialog zwischen Kunst und Forschung in diesem Bereich fortdauern; das Wissen um seine Geschichte kann dabei zu einer Präzision des Ausdrucks sowie einer Schärfung der resultierenden politischen Intentionen beitragen. Denn mehr denn je gilt es für die Künste der Gegenwart und der Zukunft, die Frage anzugehen, „welche Welt wir wollen“ (Scherer 2020, o. S.).
Reactive Visuals/Abbildungen: Max Schweder @drzerschwederer. Schweders visuelle Arbeiten mit Mitteln der Echtzeit-Animation wurden unter anderem bei Konzerten der Dortmunder Philharmoniker und dem Electro-Duo CYLVESTER eingesetzt. In Zusammenarbeit mit Chikashi Miyama entwickelte er das Klangvisualisierung-Toolset SOUNDVISION. Er ist Alumni der Akademie für Theater und Digitalität Dortmund, und Fellow der KHM Köln, sowie dem Royal Conservatoire Antwerp (BE). Max Schweder lebt und arbeitet in Köln.
Quellen:
Zu Mind The Brain!:
Webseite: https://www.myndstorm.me/ (zuletzt aufgerufen am 8.8.2021)
Case Study: https://www.dokfest-muenchen.de/events/view/4227 (zuletzt aufgerufen am 8.8.2021)
Publiziertes Interview mit Oliver Czeslik: https://xrhub-bavaria.de/5-fragen-an-oliver-czeslik-von-mind-the-brain/ (zuletzt aufgerufen am 8.8.2021)
Literatur:
Buehler, Markus, „Markus Buehler on setting coronavirus and AI-inspired proteins to music“, MIT News, 2020; (https://news.mit.edu/2020/qa-markus-buehler-setting-coronavirus-and-ai-inspired-proteins-to-music-0402; zuletzt aufgerufen am 8.8.2021)
Burckhardt, Martin, Going viral!, Matthes & Seitz, Berlin 2021
Drees, Stefan, „Von »mixed media« zum »extended performer«: Eine fragmentarische Geschichte medialer Erweiterungen des menschlichen Körpers“, in: Body sounds. Aspekte des Körperlichen in Neuer Musik, hrsg. von Jörn Peter Hiekel (= Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt 57), Mainz [u.a.]: Schott 2017
Hopp, Wienfried, Kurzwellen von Karlheinz Stockhausen, Schott, Mainz 1998
Pousseur, Henri, „Scambi“, in: Gravesaner Blätter (Heft Nr. 13), hrsg. v. Hermann Scherchen, Ars Viva Verlag, Mainz 1959 (verfügbar unter: https://archiv.adk.de/objekt/2971394)
Rheinberger, Hans-Jörg, „Über den Eigensinn epistemischer Dinge“, in Vom Eigensinn der Dinge, hrsg. v. Hans Peter Hahn, Neofelis Verlag, Berlin 2015
Scherer, Bernd, „SARS-COV-2 oder die Begegnung mit uns selbst“, 2020 (https://www.hkw.de/de/hkw/mag/bernd_scherer_sars_cov2_or_the_encounter_with_ourselves.php; zuletzt aufgerufen am 8.8.2021)
Stockhausen, Karlheinz, „Aktuelles“, in die Reihe – Information über serielle Musik, Band 1, hrsg. v. Herbert Eimert unter Mitarbeit v. Karlheinz Stockhausen, Universal Edition, Wien 1955
Taylor, Phil, „Louis Barron: Pioneer of Tube Audio Effects“, https://www.effectrode.com/knowledge-base/louis-barron-pioneer-of-tube-audio-effects/ (zuletzt aufgerufen am 8.8.2021)
Ungeheuer, Elena und Decroupet, Pascal, „Technik und Ästhetik der elektronischen Musik“, in Musik und Technik, hrsg. v. Helga de la Motte-Haber und Rudolf Frisius, Schott, Mainz 1996
Ungeheuer, Elena, „Elektroakustische Musik: Ansätze zu einer Klassifikation“, in: Elektroakustische Musik, hrsg. v. E. Ungeheuer, (Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert, Band 5), Laaber-Verlag, Laaber 2002
Weidlé, Wladimir, (unter Mitarbeit von Halperin Elaine P.), „Biology of Art: Initial Formulation and Primary Orientation“, Diogenes 1957; 5(17):1-15 (doi:10.1177/039219215700501701)
Wiener, Norbert, Cybernetics or control and communication in the animal and the machine, M.I.T. Press, Cambridge 1948
Wieser, Wolfgang, Organismen, Strukturen, Maschinen, Fischer Bücherei, Frankfurt am Main 1959

Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.